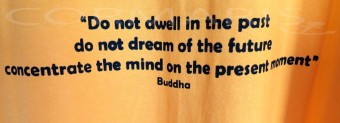Das Kätzchenchen, das mich kurz den Hunden untreu werden ließ. Ohne Steigerung wäre selbst der Diminutiv bei diesem Tierchenchen zu groß. Foto: cku
Wir hielten an einem Supermarkt, also an einem Bretterverschlag am Straßenrand, an. Eine Mitfahrende wollte Haargummis kaufen, nach jahrelanger Kurzhaarfrisur hatte sie nur zwei eingepackt für die Reise, eines davon schon verloren und war nun nervös, was unterwasser mit dem ungewohnt langen Schopfe zu tun sei, wenn dieser sich nicht vom verbliebenen Gummi allein bändigen ließe. Ich stieg mit aus, als Frau von Welt, als diejenige, die dort fremdenführt, wo sie selbst noch fremd ist, das aber äußerst souverän versteckend.
„Forget the Haargummis, ich nehm‘ das da!“, dachte ich allerdings beim Zuschreiten auf die Bretterbude. Ein Kätzchen, dessen getigerter Körper an dieser Stelle nichts anderes zulässt als den Gebrauch des Diminutiv, stand auf allen seinen vier centstückgroßen Pfötchenchen – nennen wir diese Form eine der Situation angemessene Steigerung des Diminutiv – löwengleich auf schmutzig-weißen Fliesen und starrte die Ankommenden an.

Größenvergleich: In die Filztasche (links) passt nicht mal ein iPhone, das Kätzchen (rechts) passt zwar in mein Herz, jedoch nicht in meine Filztasche, sonst hätte ich es unauffällig weggeschmuggelt. Foto: cku
Klapperdürr und selbstbewusst, kaum größer als das von mir getragene Filztaschen-Portemonnaie, in das nicht mal ein iPhone passt. Das Ganze ereignet sich in der Nähe von Singaraja, ausgerechnet jener Stadt, deren Name „König der Löwen“ bedeutet. Ich begegne also der miauenden Majestät höchstselbst auf der Stufe eines balinesischen Tante-Emma-Ladens. Eine Pygmy-Katze, maximal so schwer wie eine Blaumeise, hat mein Herz geschnappt.
Ich bin Hundemensch, durch und durch. Bei Welpen jeglicher Form, Farbe und Größe werfe ich mich jederzeit und unkontrollierbar selbst in besten Klamotten wahlweise auf regennassen Schlamm/Waldboden/Asphalt – je nachdem, wo der Welpe mir begegnet, und kraule, eher knuddele den Hund und streichle mit Zeige- und Mittelfinger zwischen den Augen, von der faltigen Welpenstirn bis zur Schnauze; das mögen sie alle. Ich kriege dann diesen verträumten Ausdruck in den Augen, die Mundwinkel können nicht anders als sich gemeinschaftlich nach oben zu ziehen, jeder an seiner Seite, versteht sich. Ich spreche auch immer mit dem Welpen; grundsätzlich zuerst mit dem Welpen, erst dann kommt der Hundehalter. Das ist natürliches Welpenbegegnungsverhalten. Oder sagen wir: Das ist mein natürliches Welpenbegegnungsverhalten.
Dann kommt da dieses Kätzchen-Schätzchen des Weges und lässt mich genau das tun: willenlos gen Boden sinken, sinnfreies Zeug in Heiteitei-Anmutung brabbeln und mit einem Finger sanft über den Katzenkopf streicheln, an dem die Ohren genauso lang sind wie das ganze Gesicht. Das Tier ist so winzig, dass ich nur einen Finger nehme, und selbst dabei befürchte ich, etwas kaputtzumachen.
Ich hatte aufgrund meiner kaltherzigen Katzenvertreiberei, der ich täglich nachgehe, schon gemutmaßt, endgültig zur schlechten Person geworden zu sein, die nicht nur viele Menschen äußerst lästig findet, sondern nun auch noch Tieren emotionslos gegenübersteht.
Entwarnung! Mein Karma ist okay, meinem inneren Ohmmm scheint es so gut zu gehen, dass es mich zu schmutzigen Fremdkätzchen in den Staub drückt.
Darauf gleich einen Sinnspruch, den ich kurz nach der Katzenbegegnung im Vorraum eines buddhistischen Tempels allein deshalb fotografierte, um die Mitlesenden weiterhin an meinem Verstand zweifeln zu lassen.
Der Tag wurde allerdings noch skurriler. Im Café einer Kaffeeplantage, in dem ich Vanillekaffee aus Kokosnuss-Geschirr trank und mich dabei wie in einer Puppenstube fühlte, saß etwas dreckig-weißes Felliges unter einem der Tische. „Och, ein Terrier“, dachte ich.
Dann schaute ich genauer hin und tausche an dieser Stelle das Wort „Puppenstube“ aus dem vorvorletzten Satz gegen „Alice-im-Wunderland-Verfilmung“. Es war ein Kaninchen. Passenderweise ein Löwenköpfchen, um im Singa-Thema zu bleiben. Es saß einfach da rum und putzte sich den Schlamm aus dem Fell, als sei es völlig normal, ein fettes Albinokaninchen zu sein und bei Platzregen unter einem balinesischen Kaffeetisch zu hocken. Sachen gibt’s.